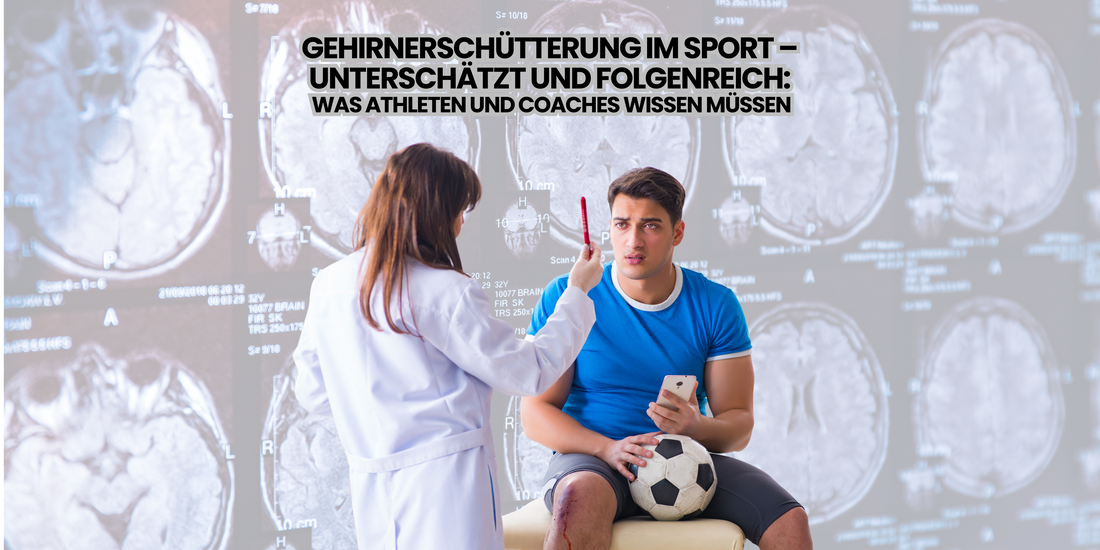
Gehirnerschütterung im Sport – unterschätzt und folgenreich: Was Athleten und Coaches wissen müssen
Share
Kleine Verletzung, große Folgen?
Eine kurze Kollision beim Fußball, ein Check beim Eishockey, ein unglücklicher Sturz beim Radtraining – oft wirken diese Szenen harmlos. Doch was viele unterschätzen: Hinter einer solchen Situation kann sich eine Gehirnerschütterung (auch "Concussion" genannt) verbergen – mit weitreichenden Folgen. Studien zeigen, dass bis zu 15% aller sportbezogenen Gehirnerschütterungen länger als zehn Tage Symptome verursachen, bei Sportarten wie Eishockey sogar deutlich mehr. Und auch wenn die Symptome zunächst unscheinbar wirken, kann eine nicht ausreichend behandelte Gehirnerschütterung zu verlängerten Ausfallzeiten, Leistungsabfall oder gar chronischen Beschwerden führen.
Was passiert bei einer Gehirnerschütterung?
Eine Gehirnerschütterung ist eine milde Form der Schädel-Hirn-Verletzung, ausgelöst durch einen direkten oder indirekten Schlag gegen den Kopf, Hals oder Körper, bei dem eine Beschleunigung des Gehirns im Schädel auftritt. Dies löst eine komplexe Kaskade von neurochemischen Prozessen im Gehirn aus: Eine vorübergehende Störung des Stoffwechsels, eine veränderte Durchblutung sowie Entzündungsprozesse.
Was sind typische Symptome?
Die Symptome sind vielfältig und können sich sofort oder mit Verzögerung zeigen:
- Kopfschmerzen
- Übelkeit oder Erbrechen
- Schwindel, Gleichgewichtsstörungen
- Licht- und Geräuschempfindlichkeit
- Konzentrations- und Gedächtnisprobleme
- "Nebel im Kopf" oder Verlangsamung des Denkens
- Schlafstörungen
- Emotionale Reizbarkeit oder depressive Verstimmung
Diese Symptome sind nicht spezifisch, was die Diagnosestellung erschwert – umso wichtiger ist eine genaue und strukturierte Beurteilung.
Wie läuft die Rehabilitation ab? Das 6-Stufen-Modell
Die moderne Rehabilitation nach einer Gehirnerschütterung folgt einem strukturierten 6-stufigen Modell, welches von internationalen Experten auf dem Gebiet empfohlen wird. Ziel ist es, Athleten sicher und individuell angepasst zurück in den Sport zu führen – und dabei Risiken für Rückfälle oder Langzeitschäden zu minimieren.

Phase 1: Symptom-limitierte Alltags-Aktivität
-
Ziel: Körperliche und geistige Ruhe, aber keine vollständige Immobilität.
-
Inhalt: Alltägliche Aktivitäten, die keine Symptome auslösen (z. B. Spazierengehen, Lesen).
-
Nächste Stufe: Wenn Symptome mindestens 24 Stunden stabil bleiben.
Phase 2: Leichte aerobe Aktivität
-
Ziel: Wiederherstellung grundlegender Belastbarkeit.
-
Inhalt: Leichtes aerobes Training, z. B. 10–15 Minuten lockeres Radfahren oder Laufbandgehen bei <70 % der maximalen Belastung.
-
Nächste Stufe: Kein Symptomanstieg während oder nach Belastung.
Phase 3: Individuelles sportartspezifisches Training
-
Ziel: Erste Rückkehr zur sportlichen Bewegung außerhalb des Teams.
-
Inhalt: Z. B. Skating für Eishockeyspieler oder lockeres Passen beim Fußball.
-
Wichtig: Alles noch ohne Kontakt
-
Nächste Stufe: Kein Symptomanstieg während oder nach Belastung.
Phase 4: Teamtraining & Komplexe Drills ohne Kontakt
-
Ziel: Wiederaufnahme des Teamtrainings (nur Drills ohne Kontakt) und Steigerung der Komplexität.
-
Inhalt: Passübungen, Reaktionstraining, Intervalltraining.
-
Nächste Stufe : Keine Symptome bei komplexen Trainingsformen.
Phase 5: Uneingeschränkte Rückkehr ins Teamtraining mit Kontakt
-
Ziel: Freigabe durch medizinisches Fachpersonal, Rückkehr ins Teamtraining mit Körperkontakt.
-
Inhalt: Teilnahme an vollständigen Trainingseinheiten inkl. Zweikämpfe.
-
Nächste Stufe: Beschwerdefreie Teilnahme an mehreren Trainingseinheiten.
Phase 6: Rückkehr in den Wettkampf- und Spielbetrieb
Die Rehabilitation ist geschafft und der Sportler kann in den normalen Wettkampf- und Spielbetrieb zurückkehren.
Wichtig! Zwischen jeder Stufe sollte mindestens ein beschwerdefreier Zeitraum von 24 Stunden liegen. Bei Rückkehr von Symptomen: zurück zur vorherigen Stufe und frühestens nach erneuter Beschwerdefreiheit den nächsten Versuch starten.
"Diifficult Concussion" – Was tun, wenn die Rehabilitation stockt?
In 10–30 % der Fälle dauert die Genesung länger als 10 Tage. In solchen Fällen ist ein interdisziplinärer Ansatz wichtig – inklusive neurologischer und psychologischer Abklärung. Unterstützend wirken:
-
Subsymptomatisches Training ohne Symptomverschlechterung (z. B. kontrolliertes Ausdauertraining)
-
Vestibuläre oder visuelle Rehabilitation
-
Kognitive Verhaltenstherapie bei anhaltender Angst oder Stimmungsschwankungen
-
Schlaf- und Stressmanagement
Fazit
Eine Gehirnerschütterung ist immer ernst zu nehmen! Der Heilungsverlauf ist individuell. Zwar kehren viele Athleten nach 1-3 Wochen vollständig zurück, doch bei anderen kann die Genesung deutlich länger dauern. Das strukturierte Stufenmodell der Rehabilitation bietet einen sicheren Leitfaden für eine schrittweise Rückkehr – angepasst an die Symptome und Belastbarkeit.
Die wichtigste Botschaft: "When in doubt – sit them out." Wenn auch nur ein Verdacht auf eine Gehirnerschütterung besteht, sollte der betroffene Sportler aus dem Training oder Spiel genommen und ärztlich begutachtet werden. Die Gesundheit hat oberste Priorität – immer.
